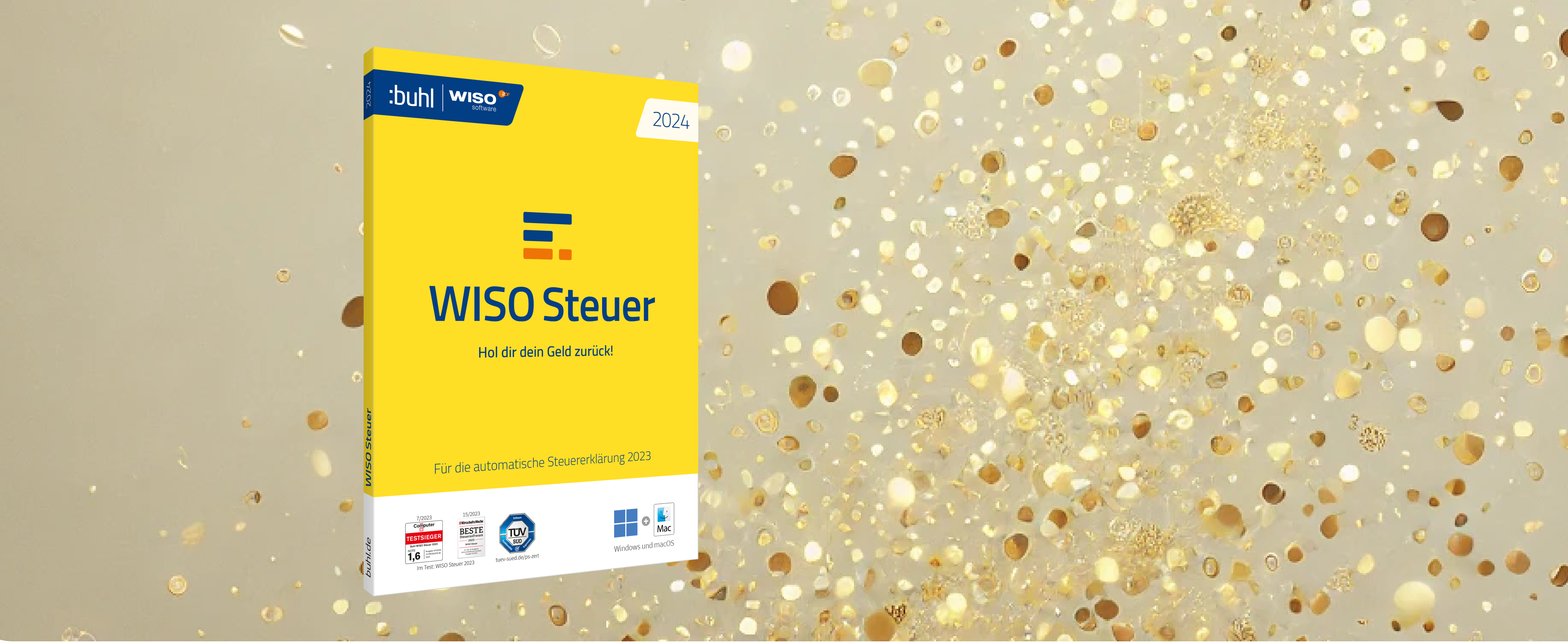Hohe Energiekosten, stark gestiegen Lebensmittelpreise – wohin man auch schaut, alles wird teurer. Die Folge: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, während der Mittelstand langsam zu verschwinden scheint. Und mit den steigenden Preisen werden auch die Forderungen nach der Vermögenssteuer immer lauter. Aber was ist das überhaupt?
Schnelleinstieg
Kurz & knapp
- Mit der Vermögenssteuer soll das gesamte Reinvermögen besteuert werden
- Ziel ist es, vermögende Bürger und Unternehmen stärker zu besteuern, um finanziell Schwächere zu entlasten
- Die Vermögenssteuer gibt es in Deutschland seit 1996 nicht mehr
Was ist die Vermögenssteuer?
Die Vermögenssteuer – auch bekannt als Millionärssteuer – gibt es seit 1996 nicht mehr in Deutschland. Trotzdem kommen immer wieder Diskussionen auf, ob die Steuer wiedereingeführt werden soll.

Die Vermögenssteuer wird auf das gesamte Reinvermögen einer Person erhoben. Der Gedanke dahinter: Personen mit einem hohen Vermögen sollen stärker besteuert werden. Das soll wiederum weniger vermögende Menschen entlasten. Die Steuer würde auf folgende Vermögenswerte erhoben werden:
- Grundvermögen (Gebäude und Grundstücke, Erbbaurecht, Wohneigentum etc.)
- Finanzvermögen (Bargeld, Bankguthaben, Wertpapiere, Forderungen, Anteilsrechte etc.)
- Betriebsvermögen (ohne Altersvorsorgeansprüche und Hausrat)
- abzüglich der Schulden, die auf den steuerpflichtigen Vermögen liegen
Beispiel: Was zählt als Vermögen?
Stefan kauft sich ein Eigenheim für 600.000 Euro. Dafür nimmt er einen Kredit von 300.000 Euro auf.
Dieser Kredit wird von seinem Vermögen abgezogen. Als Reinvermögen bleiben damit 300.000 Euro übrig. Als Vermögen zählt also nur, was Stefan tatsächlich gehört.
Gibt es einen Freibetrag?
Es soll nicht das komplette Vermögen gleich ab dem ersten Euro versteuert werden. Damit auch wirklich nur hohe Vermögen belastet werden, soll es einen Freibetrag geben. Doch: Ab wann fängt Reichtum an? Manche fordern, die Steuer ab einem Reinvermögen von 1 Million Euro zu erheben.
Die Vermögenssteuer kann sowohl auf das Reinvermögen von Einzelpersonen als auch auf das Familienvermögen erhoben werden. Ähnlich wie bei der Einkommensteuer, bei der auch Ehepartner zusammen veranlagt werden. Auch Kinder können so mitberücksichtigt werden.
Neben der Vermögenssteuer gibt es noch die Möglichkeit einer Vermögensabgabe. Diese wird im Gegensatz zur Vermögenssteuer nur einmalig erhoben.
Wo gilt die Vermögenssteuer heute?
In vielen Ländern wurde die Vermögenssteuer eingeführt, aber nur noch wenige haben sie heute noch. Es gibt sie nur noch in einer Handvoll OECD-Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, Frankreich und Norwegen.
Die Länder Schweden, Österreich, Italien oder die Niederlande haben sie bereits wieder abgeschafft. In Spanien wurde sie befristet wiedereingeführt. In Frankreich wurde sie 2018 in eine reine Immobiliensteuer umgewandelt.
Doch auch wenn die Vermögenssteuer in vielen Ländern gestrichen wurde, bleiben vermögensbezogene Steuern weit verbreitet. Auch in Deutschland. Dazu zählen zum Beispiel die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer oder Grundsteuer. Der Unterschied: Diese versteuern nicht das Kapitalvermögen, sondern beziehen sich auf andere Vermögenswerte.
Die Vor- und Nachteile von Vermögenssteuer
Wie so ziemlich alles auf dieser Welt hat auch die Vermögenssteuer-Medaille 2 Seiten. Und seit der Abschaffung der Steuer streiten sich Befürworter und Kritiker über die Wiedereinführung. Wir haben die wichtigsten Argumente für und gegen die Vermögenssteuer zusammengefasst:
Argumente für die Vermögenssteuer
Kritik an der Vermögenssteuer
Wie realistisch ist die Wiedereinführung der Vermögenssteuer?
Seit der Abschaffung der Steuer gibt es immer wieder Diskussionen über deren Wiedereinführung. Vor allem die Kassen der Bundesländer, denen die Einnahmen früher zuflossen, würden sich über eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer freuen.
In der Realität ist es aber eher unwahrscheinlich, dass die Vermögenssteuer – zumindest in absehbarer Zeit – wiederbelebt wird. Denn einige Faktoren machen diese Steuerform kaum umsetzbar. So zum Beispiel der erhebliche Aufwand für Finanzämter, aber auch Unternehmen und Privatleute.
Zudem gibt es auch keine Lösungen, die die Durchsetzung der Vermögenssteuer lukrativ machen würden. Immerhin müsste ein gutes Drittel der Steuereinnahmen nur für Erhebung der Steuer benutzt werden.
Auch der aktuelle Bundesfinanzminister Christian Lindner positioniert sich gegen die Vermögenssteuer. Er sieht ein mögliches Risiko vor allem darin, dass Reiche ihr Vermögen ins Ausland verlagern, wenn in Deutschland eine Steuer darauf droht. Er fordert aber: “Wir müssen unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ansonsten drohen wir Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft an andere Standorte auf der Welt zu verlieren. Um das zu verhindern, brauchen wir eine Steuerreform.”
Die Geschichte der Vermögenssteuer in Deutschland
Die Vermögenssteuer ist eine der ältesten Steuern der Weltgeschichte, deren Wurzeln bis ins alte Ägypten reichen. In Deutschland wurde sie zuerst einmalig im Mittelalter und später dann regelmäßig erhoben. Als im 19. Jahrhundert die Einkommensteuer eingeführt wurde, wurde aus der Vermögenssteuer schließlich eine Ergänzungssteuer.
Steuersatz
- Von 1923 bis 1996 wurde die Vermögenssteuer durchgängig erhoben.
- Zu Beginn lag der Steuersatz zwischen 0,1 und 1 Prozent.
- Ab 1978 betrug der Steuersatz 0,5 Prozent (0,7 Prozent für juristische Personen).
- Im Jahr 1995 wurde er auf 1 Prozent verdoppelt.
In den neuen Bundesländern wurde die Vermögenssteuer nicht erhoben. Trotzdem wurde sie in den alten Bundesländern auch nach der Wende erstmal nicht ausgesetzt. Das Aufkommen der Steuer wurde den Bundesländern zugewiesen.
Auch interessant:
Steuereinnahmen
Viel Geld hat die Vermögenssteuer nie in die Kassen gespült. Trotzdem hatte sie immer eine spürbare Bedeutung für den Haushalt.
- In den 1920er Jahren wurden damit 0,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) eingenommen.
- In den 50er und 60er Jahren verringerten sich die Einnahmen auf circa 0,4 Prozent des BIP.
- In den 1980er Jahren sanken die Einnahmen weiter auf 0,3 Prozent des BIP.
- In den 90er Jahren lagen sie nur noch bei 0,2 Prozent.
Das Ende der Vermögenssteuer in Deutschland
Nach langjähriger Prüfung erklärte das Bundesverfassungsgericht 1995 die Vermögenssteuer für verfassungswidrig. Ende 1996 wurde sie in Deutschland aufgehoben. Die Karlsruher Richter stuften aber nur die Form der Steuer als gesetzeswidrig ein, nicht die generelle Versteuerung von vorhandenem Kapitalvermögen. Sie sahen lediglich eine ungerechtfertigte Besserstellung von Immobilienvermögen. Denn das war gegenüber anderem Kapitalvermögen günstiger gestellt.
Des Bundesverfassungsgerichtes empfahl deshalb, Immobilien höher zu bewerten und somit deren Besteuerung dem übrigen Kapitalvermögen anzupassen. Doch der Gesetzgeber machte kurzen Prozess und hob die Steuer ganz auf. Das Vermögenssteuergesetz ist aber noch bis heute gültig.
Hol dir dein Geld zurück
Ganz einfach mit WISO Steuer.